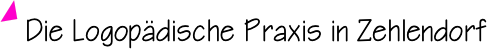Sprechstörungen bei Kindern
Worum geht es?
Ursachen
- Allgemeine Entwicklungsstörungen/-verzögerungen/-behinderungen
- Familiäre Sprachschwäche mit Krankheitswert
- Hörstörungen
- Hirnreifestörungen
- Geistige, körperliche Behinderungen, Mehrfachbehinderungen
- Genetisch bedingte Krankheiten/Syndrome (z.B. Down-Syndrom, Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten)
- Schädel-Hirn-Traumata, entzündliche Hirnprozesse
- Hirntumore, Hirnoperationen
- Orofaciale Dysfunktionen (Störungen der Mundmotorik)
Erscheinungsformen
Leitsymptome
Störungen in der Laut- und Lautverbindungsbildung (falsch gebildete Laute, Lautersetzungen) und Störungen des orofazialen Muskelgleichgewichts.
Dysarthrie:
Dysarthrien sind Störungen in der Ausführung von Sprechbewegungen und/oder der Koordination von Atmung, Stimme und Artikulation aufgrund angeborener oder erworbener Hirnstörungen.
Leitsymptome bei Dysarthrie:
Vermehrter oder verminderter Speichelfluss, gestörte Atemkontrolle, verminderte Atemkapazität, verlangsamte/eingeschränkte Beweglichkeit von Lippen, Zunge, Gaumen und Kiefer, veränderte Lautbildung/Artikulation, undeutliche Aussprache, Näseln, veränderter Stimmklang, eingeschränkte Prosodie (Sprechmelodie), veränderte Lautstärke, veränderter Sprechrhythmus.
Verbale Entwicklungsdyspraxie:
Verbale Entwicklungsdyspraxien sind zentrale Störungen der Planung der Sprechmotorik, die nicht durch eine Funktionseinschränkung der am Sprechakt beteiligten Organe zu erklären sind. Es handelt sich vielmehr um eine Störung in der Planung der Sprechmotorik.
Leitsymptome bei verbaler Entwicklungsdyspraxie:
Auffälligkeit in der Lautbildung mit hoher Variabilität der Fehler, artikulatorische Suchbewegungen, deutliche Sprechanstrengung; unwillkürliche Bewegungsmuster können besser realisiert werden als willkürliche Sprechleistungen.
Störungen im Sprechablauf, Redeflussstörungen
Kernsymptome: unfreiwillige Wiederholungen von Teilwörtern, Silben oder Lauten, Dehnungen von Lauten und/oder Blockierungen von Wörtern. Begleitsymptome: Sprechangst, Vermeidungsverhalten, Körpermitbewegungen, Einschieben von Füllwörtern.
Poltern:
Poltern ist im Gegensatz zum Stottern von einem überschießenden, sehr schnellen Sprechen gekennzeichnet. Die Aussprache ist aufgrund des Missverhältnisses von Sprechtempo und artikulatorischer Fähigkeit und Defiziten in der Wahrnehmung häufig sehr undeutlich und verwaschen. Ein Störungsbewusstsein oder Leidensdruck ist bei Polterern selten vorhanden.
Die logopädische Behandlung
Vor jeder Behandlung wird eine der Störung und dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechende Diagnostik durchgeführt. Danach wird die Behandlung in der Regel in Einzeltherapie begonnen und parallel dazu Elternberatung durchgeführt. Die Mitarbeit der Eltern ist von entscheidender Bedeutung, da viele Übungen mit dem Kind täglich durchgeführt werden müssen bzw. ein spezielles Sprachvorbild durch die Eltern erforderlich ist. Teilweise gibt es Angebote für Gruppentherapien. Bei Transport- oder Gehunfähigkeit kann die Behandlung im häuslichen Bereich des Kindes erfolgen.
Zielbereiche
- Wahrnehmung
- Atmung, Haltung/Tonus
- Sprech-/Schluckmotorik
- Artikulation/Lautbildung
- Sprechablauf
- Störungsspezifische kognitive Fähigkeiten
- Störungsspezifische Krankheitsverarbeitung
- Kommunikationsfähigkeit
- Hilfsmittelversorgung
Zeitpunkt und Dauer der Behandlung
Herausgeber: dbl – Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V., Augustinusstraße 11a, 50226 Frechen
Stand: 4. Auflage, Oktober 2004
Download des Flyers: